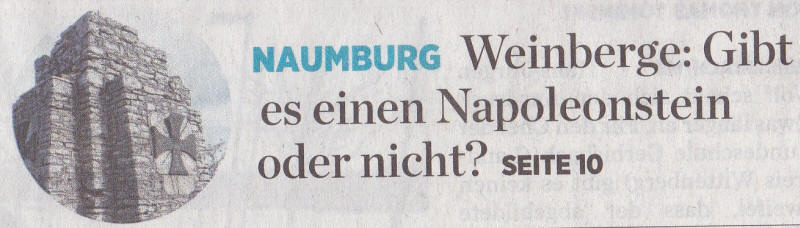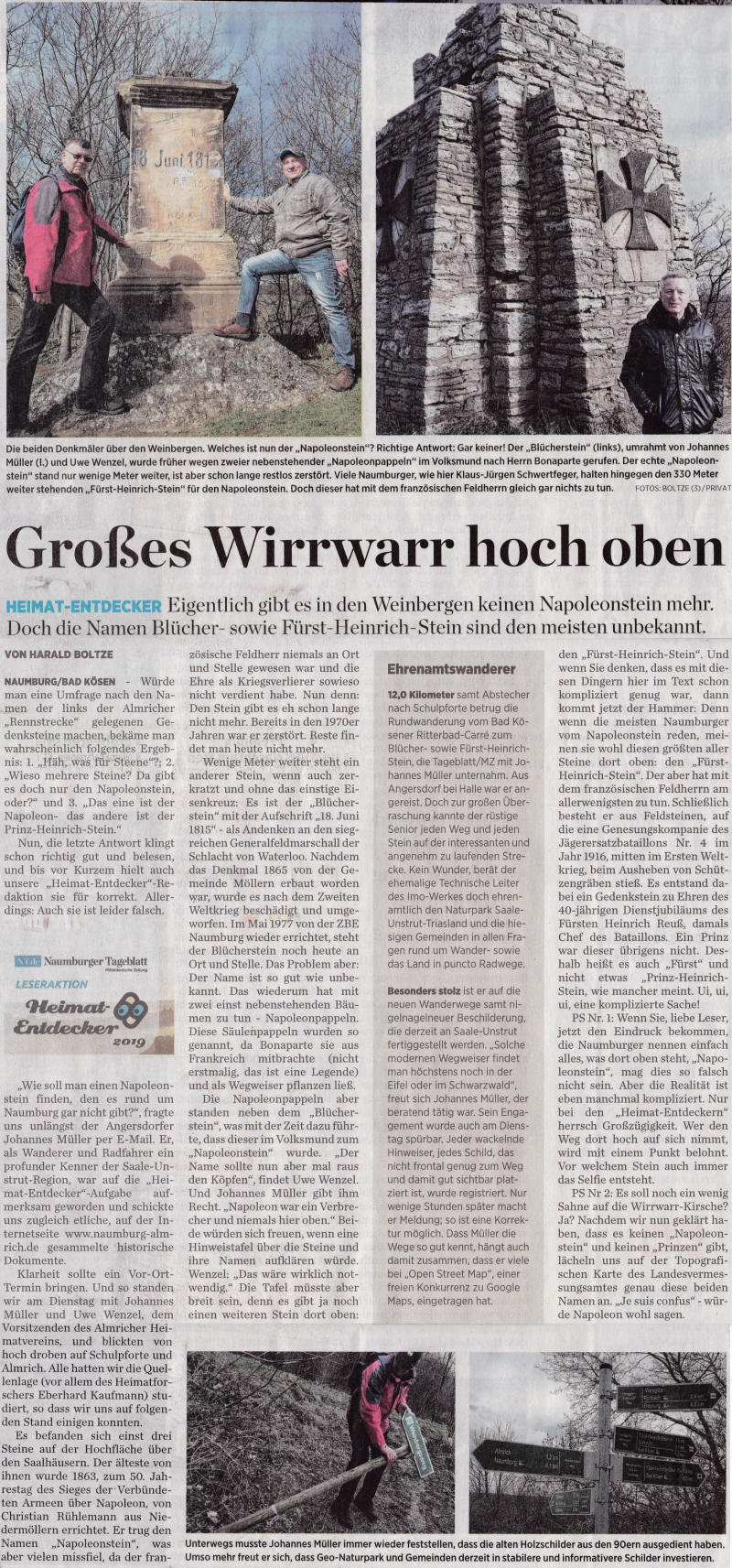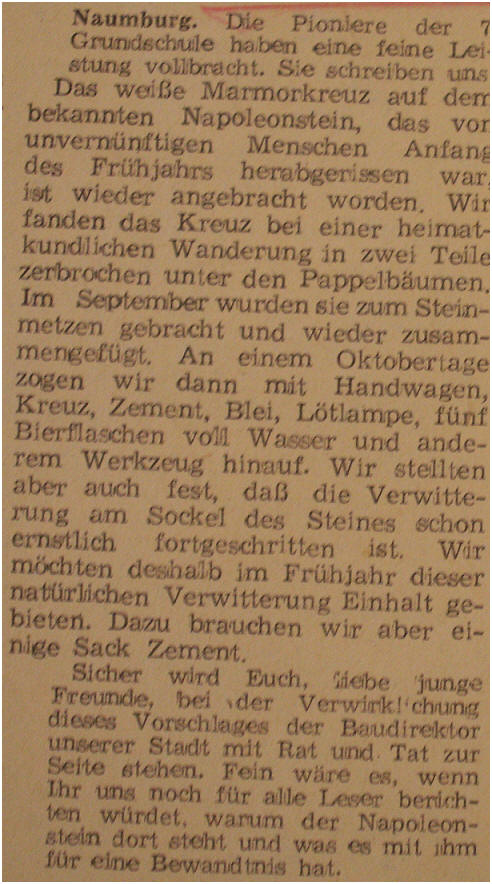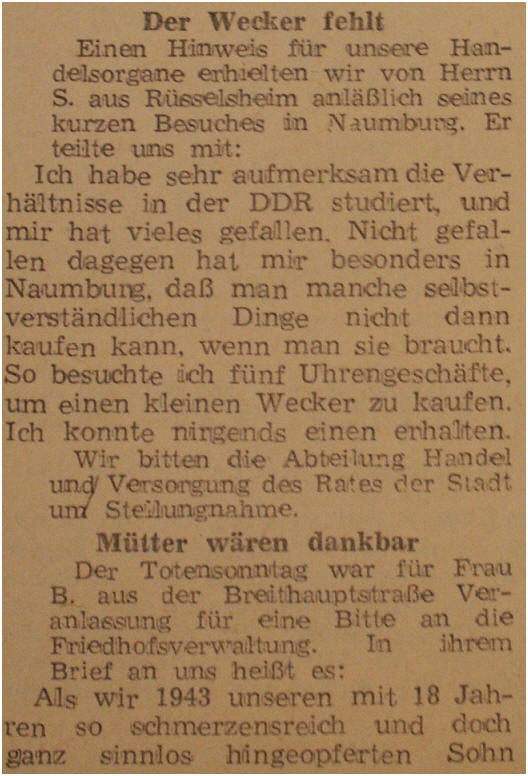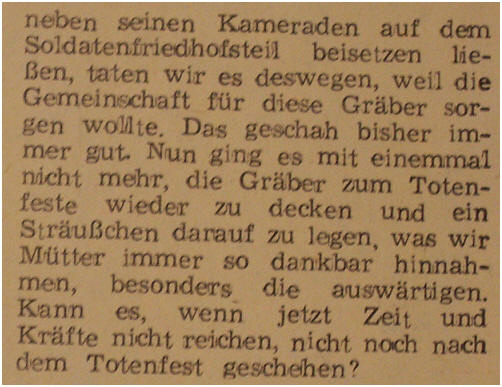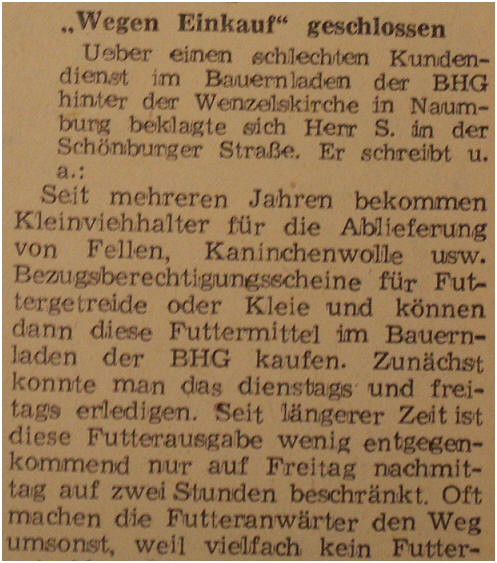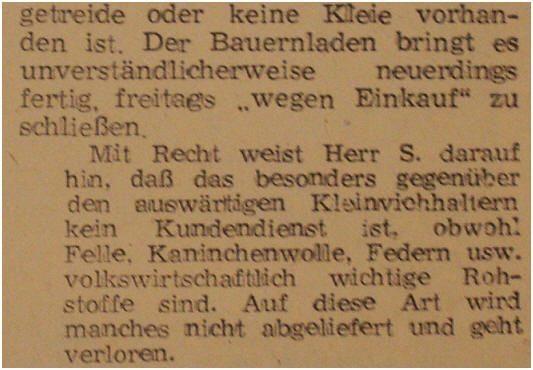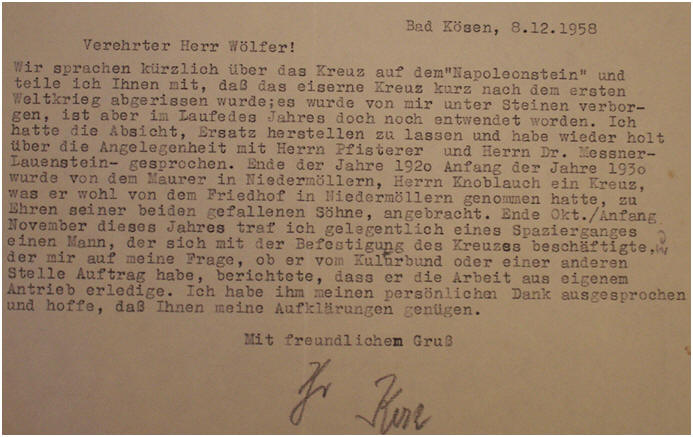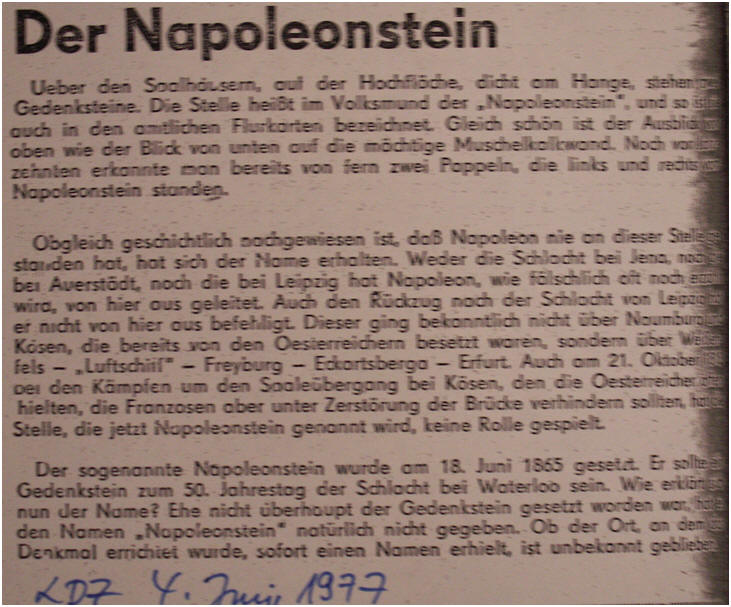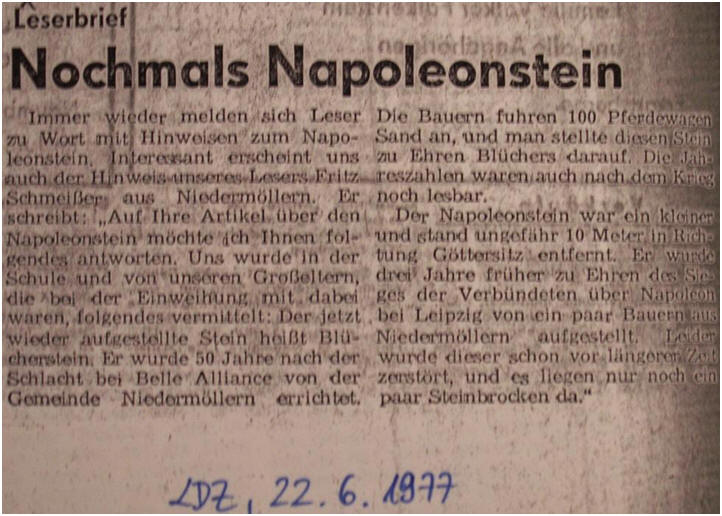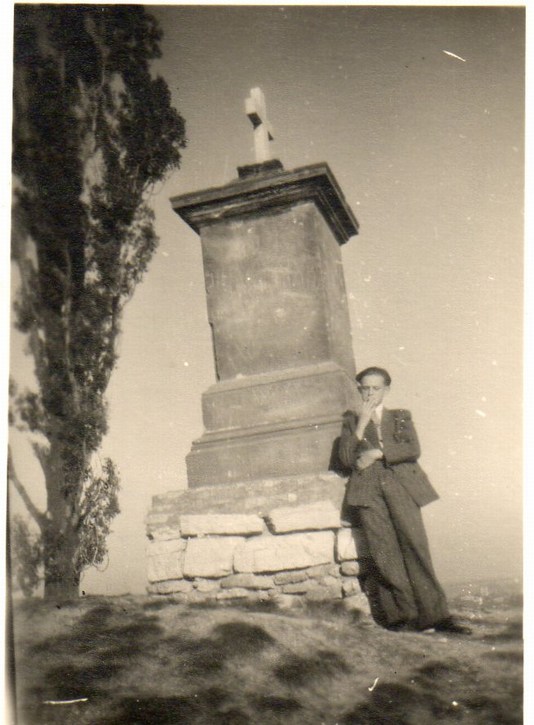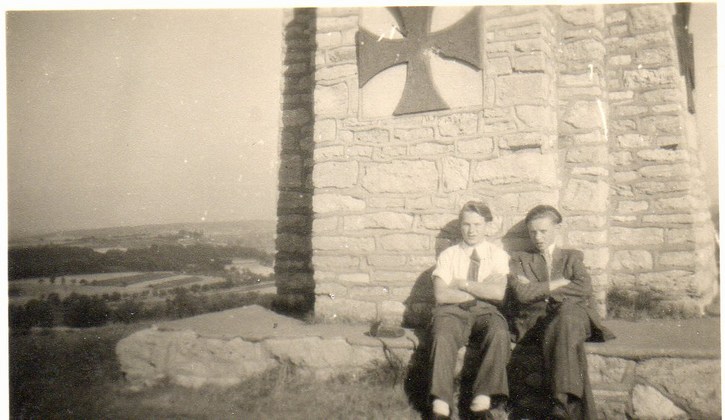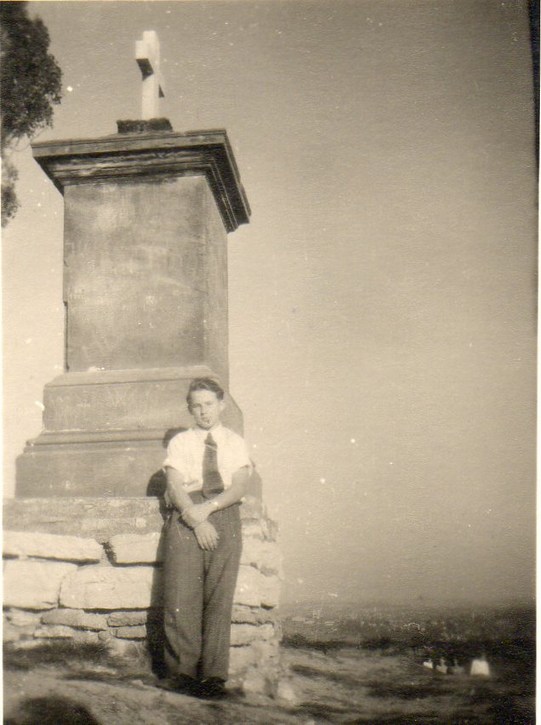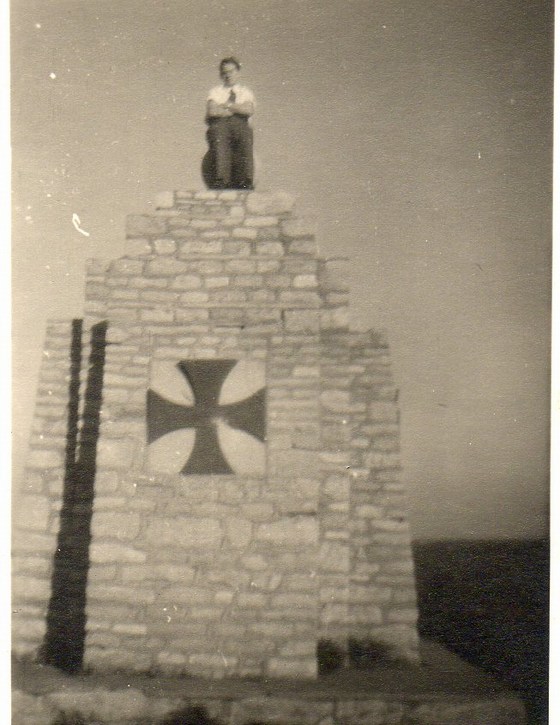Auf den Spuren der Steine . . .

SuperSonntag 23.04.2023

NTB 17.07.2020
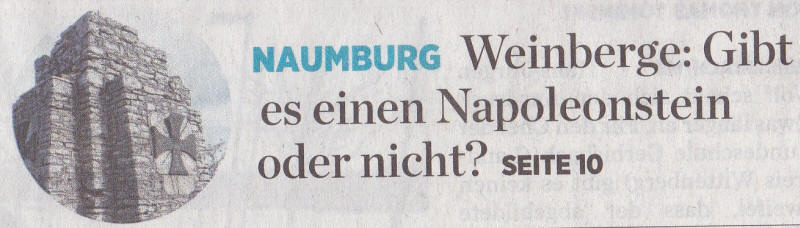
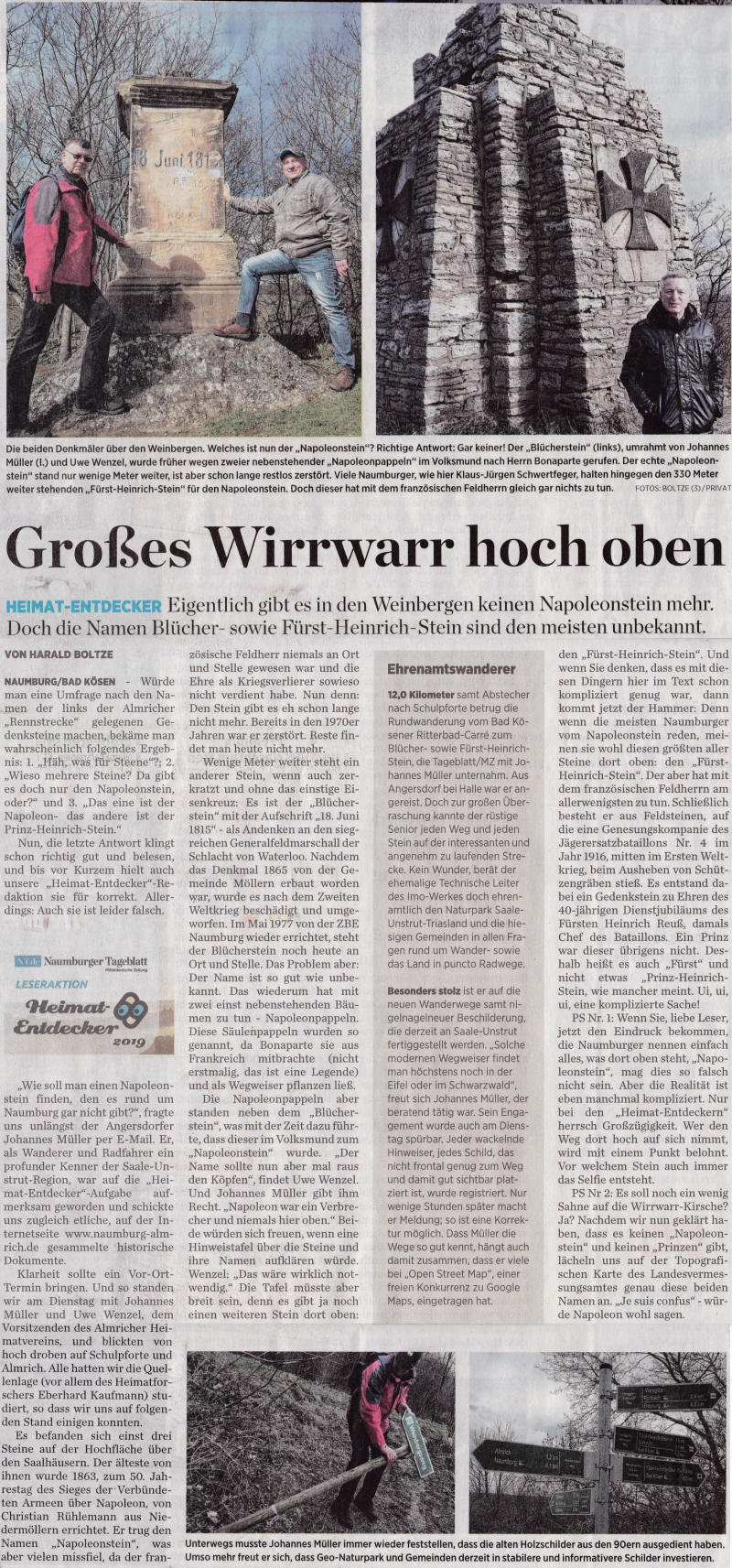
NTB 22.03.2019

Blücher Stein 19.03.2019

Herr Müller 19.03.2019

Fürst Heinrich Stein mit Sitzgruppe 19.03.2019


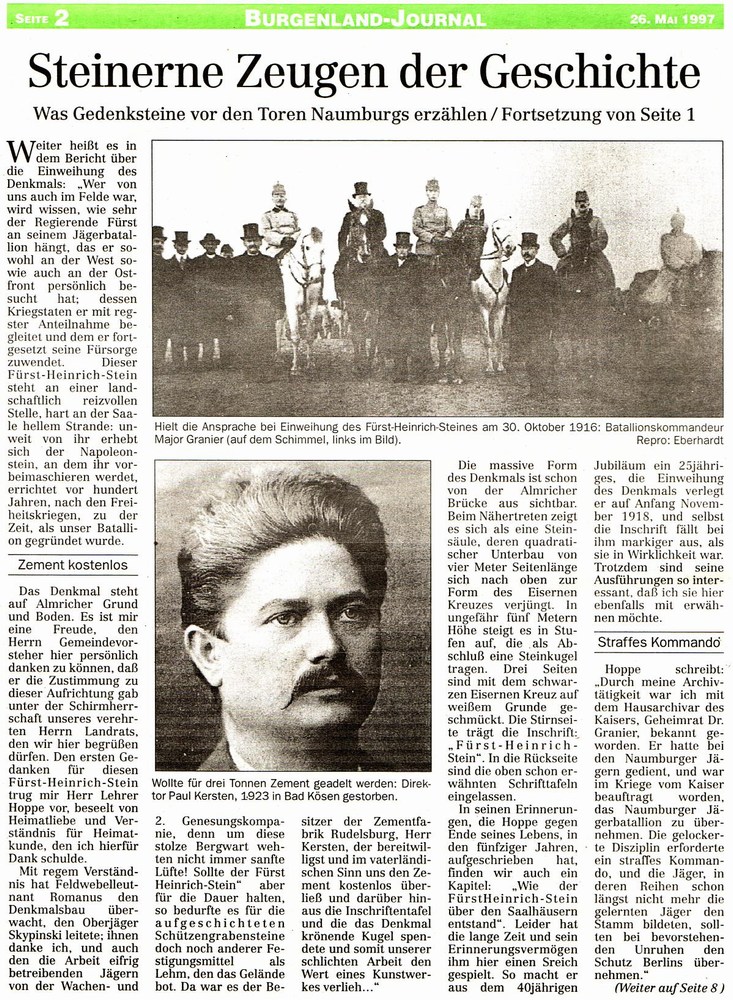

Kurze Zusammenfassung
Der
1.
Napoleonstein
steht auf der Hochfläche über den
Saalhäusern. Er wurde am 50. Jahrestag zum Andenken an die Schlacht bei Leipzig
am 18. Oktober 1813 von Christian Rühlemann aus Niedermöllern errichtet.
Rühlemann wurde am 29.04.1799 in Niedermöllern geboren, starb am 22.02.1872
dort.
Der Boden gehörte der Gemeinde Möllern bis zum Hang, dann setzte sich der Besitz
mit den Saalhäusern, somit Kösener Flur, fort. Es handelte sich um eine kleine
Säule, die vom Hang zurücktrat und später verloren ging. Sie stand etwa bis 20 m
weiter westlich in Richtung Göttersitz und wurde zerstört, den Hang hinunter
geworfen.
Der Name Napoleonstein kam auf, er wurde wiederholt beanstandet, da Napoleon
weder an dieser Stelle gewesen war, noch als Verlierer der Schlacht eine Ehrung
verdient gehabt hätte. Man versuchte, den Namen in Blücherstein zu ändern, was
sich nicht durchsetzte.
Es wurde 1865 ein 2.
Napoleonstein
errichtet, der dem Sieg von Waterloo
gewidmet war und die Inschrift jenes Tages trug: „18. Juni 1815“. Er steht in
der Höhenlage 244 m über N.N.
Dieser Gedenkstein wurde von der Gemeinde Möllern gebaut, wobei etwa 100
Bauernwagen mit Baumaterial angefahren wurden.
Auf seiner Spitze befand sich ein eisernes Kreuz, umgeben war der Stein von zwei
Pappeln. Er wurde vom Amtmann Schmidt aus Bad Kösen gestiftet, der eine kleine
Schrift mit seinem Namen anbringen ließ „Errichtet von Schmidt“ – bereits 1938
kaum noch lesbar.
Auf der Rückseite waren eingeschlagen R und W, d.h. Rex (König) und W (Wilhelm).
Es gab damals auch einen Antrag, die gesamte Höhe „Wilhelmshöhe“ zu nennen, was
sich aber trotzt amtlicher Genehmigung nicht erhielt.
In den Nachkriegsjahren des 2. Weltkrieges verschwand das Kreuz, wurde der Stein
beschädigt und umgeworfen. Die ZBE Naumburg (Baubetrieb) stellte ihn am 27. Mai
1977 wieder auf. Es gab in den 1990er Jahren eine Meldung, dass eine Arztfamilie
aus Möllern ihn reparieren wollte, wovon aber abgesehen wurde.
Der Fürst
– Heinrich - Stein
wurde mitten im 1. Weltkrieg auf
gemauert. Dazu wurde eine Genesenengruppe des Naumburger Jäger – Ersatzbatallion
Nr. 4 eingesetzt, das dort Schützengräben ausheben sollte und aus den Steinen
das Denkmal errichtete. Die Tafel hatte die Inschrift „Aus Schützengrabensteinen
im Kriegsjahr 1916 errichtet vom Jäger – Ersatzbatallion Nr. 4 zur Erinnerung an
das vierzigjährige Chefjubiläum des Fürsten Heinrich Reuß – 13.09.1916“.
(Daher taucht die Bezeichnung „Fürst – Heinrich – Stein“ auf).
Die Einweihung fand am 30.10.1916, morgens um 09:00 Uhr statt. Nach Aufstellung
des Batallions mit dem Kommandeur Major Granier wurde eine Ansprache gehalten –
der Fürst Heinrich war Chef des Batallions.
Dieses Denkmal steht auf Almricher Grund und Boden. An Baumaterial half der
Unternehmer Kersten mit Zement aus, wobei er für die Tafel und die Kugel an der
Spitze eine Spende übergab. Der Unterbau besitzt eine Seitenlänge von vier
Metern, nach oben verjüngt er sich zu einem eisernen Kreuz. Kersten wollte für
diese Leistungen geadelt werden, was ihm aber nicht zugestanden wurde.
Wer waren die Naumburger Jäger ?
Sie lagen in Naumburg in Garnison von 1873 – 1890 und von 1909 - 1912
In der Zwischenzeit von 1890 – 1909 waren sie in Colmar / Elsaß (jetzt
Frankreich) stationiert. In Naumburg waren sie in der alten Jägerkaserne (
Jägerplatz) stationiert.
Zu DDR Zeiten Rat des Kreises nach der Wende Landratsamt .
Ein weiteres Jägerdenkmal das „Langemarch – Denkmal“ stand in der Nähe des
Waldschlosses in der Neidschützer Strasse, und hatte die Form eines
Maschinengewehrbunkers. Dieses Denkmal wurde 1933 eingeweiht in Anwesenheit des
deutschen Kronprinzen. Leider wurde es durch Denkmalstürmer 1950 gesprengt.
In anderen Ländern, z.B. Groß – Britannien und Frankreich gibt diesen
Vandalismus nicht.
In Waterloo (Belgien), man kann hinkommen wo man will, jede Nation ehrt die
Denkmale und pflegt sie, bloß nicht in Deutschland ! Sind die Politiker nicht
daran schuld ?
Auch zu unseren beiden noch verbliebenen Gedenksteinen, ist der Weg sehr
beschwerlich,
zerstört durch die Mutter Natur. Vor allem für ältere Menschen ist es eine Qual
zu den Steinen zu gelangen. Der Tourismusverband oder auch die Stadt Naumburg
hat wahrscheinlich kein Interesse an der Erhaltung. Auch gibt es in keiner
Broschüre von Naumburg einen Hinweis auf diese Steine. Man hält es auch nicht
für Notwendig an den Steinen eine Hinweistafel aufzustellen. Für Touristen ist
es nicht nachzuvollziehen, um was es sich überhaupt bei den Steinen handelt. Ich
bezweifele auch, das alle Naumburger wissen, was das für Steine sind. Habe
selbst die Erfahrung gemacht, und wenn ich ehrlich bin, ich wusste es auch
nicht.
Nicht zuletzt dadurch, das es kaum Material dazu gibt.
Uwe Wenzel

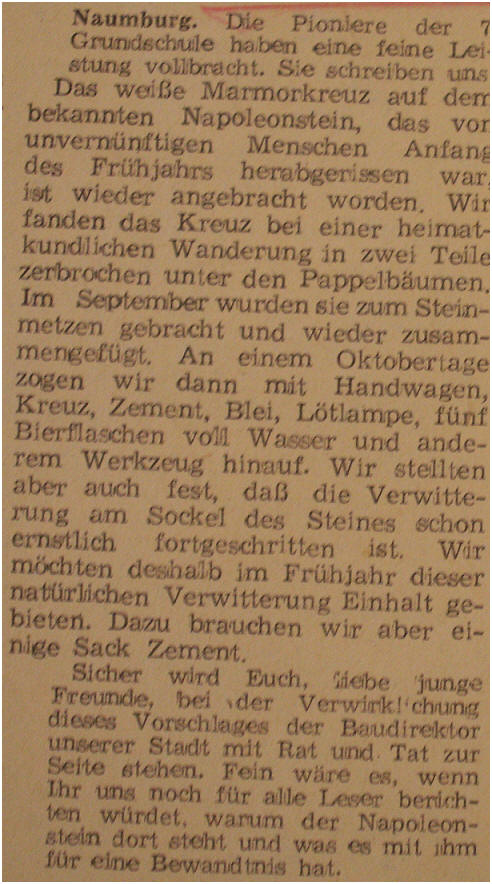
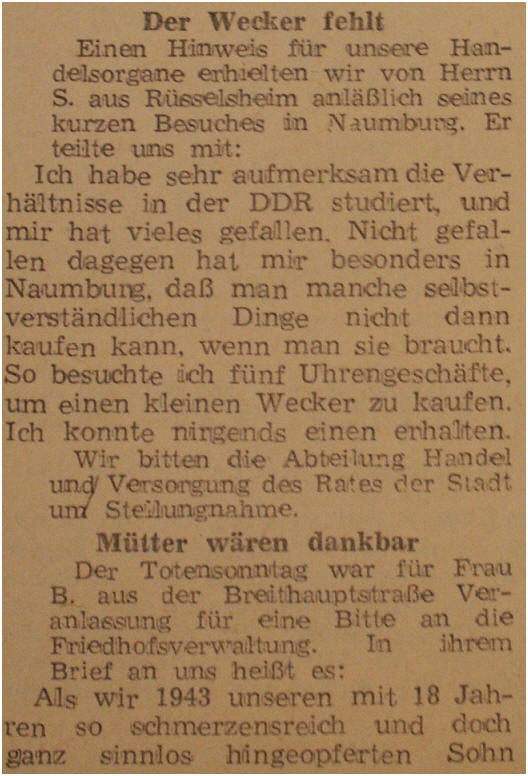
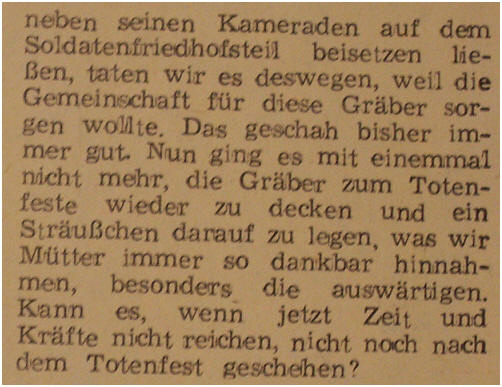
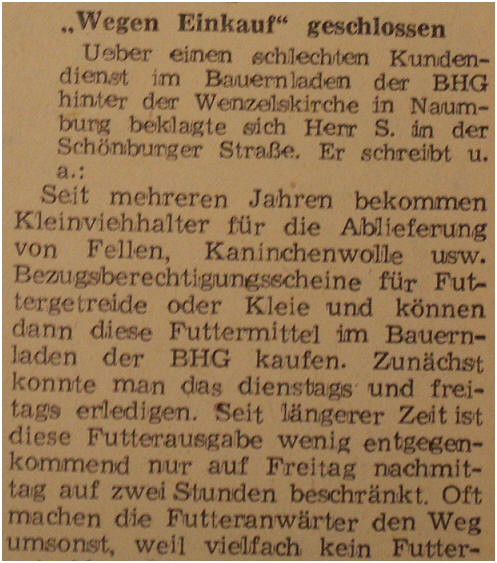
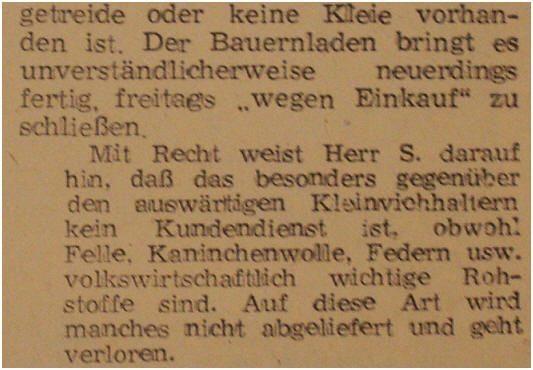
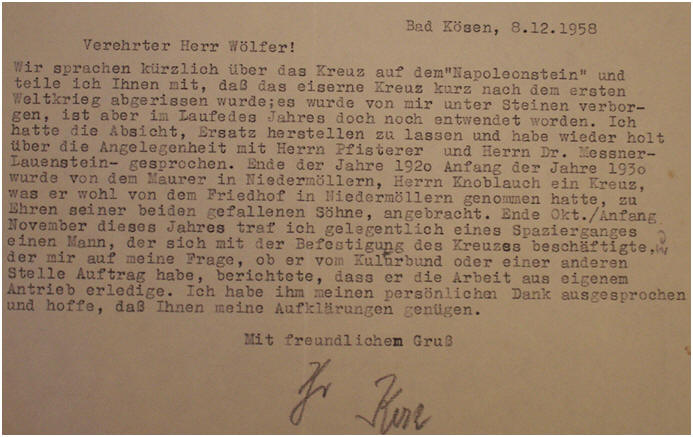
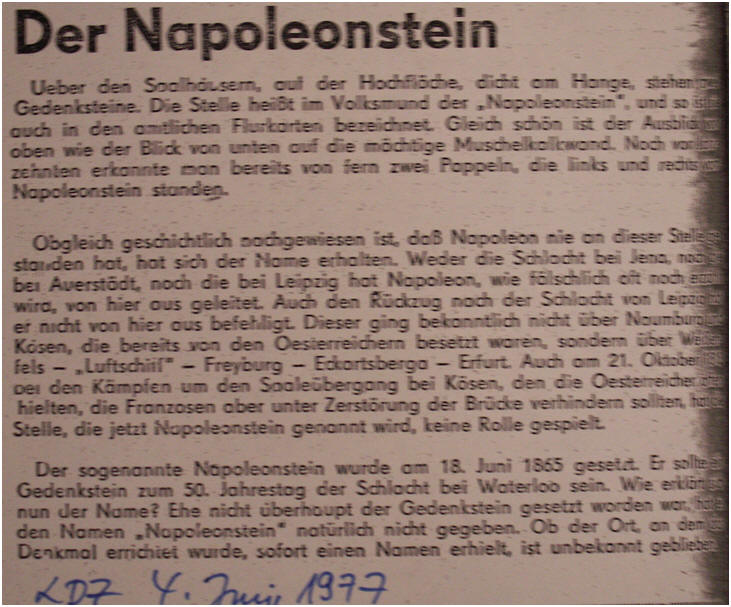
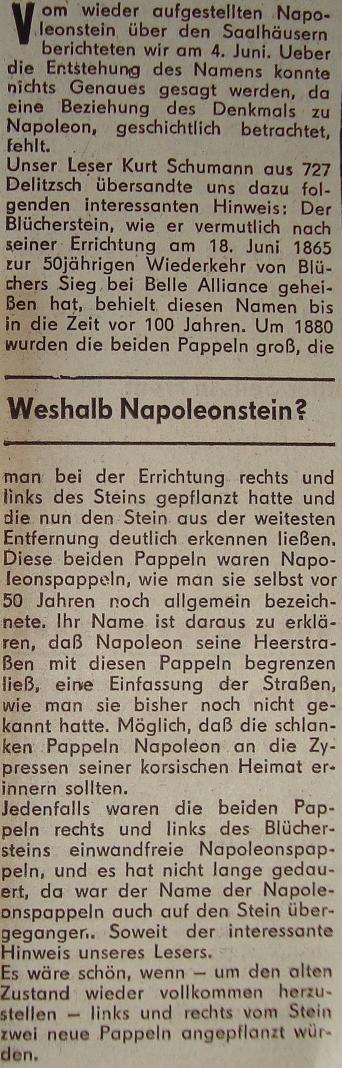
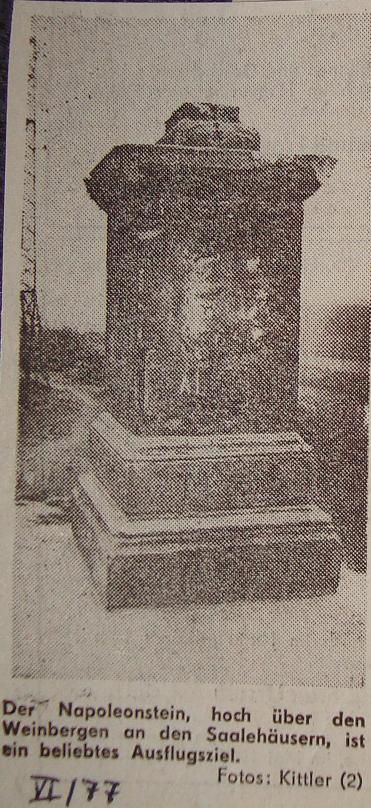
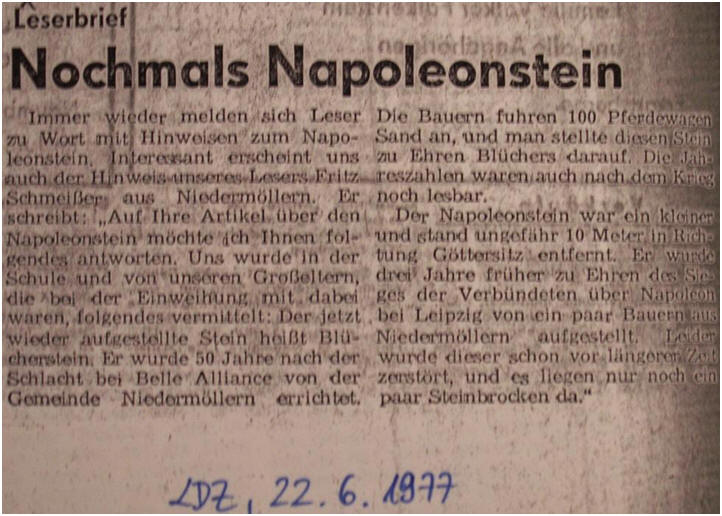

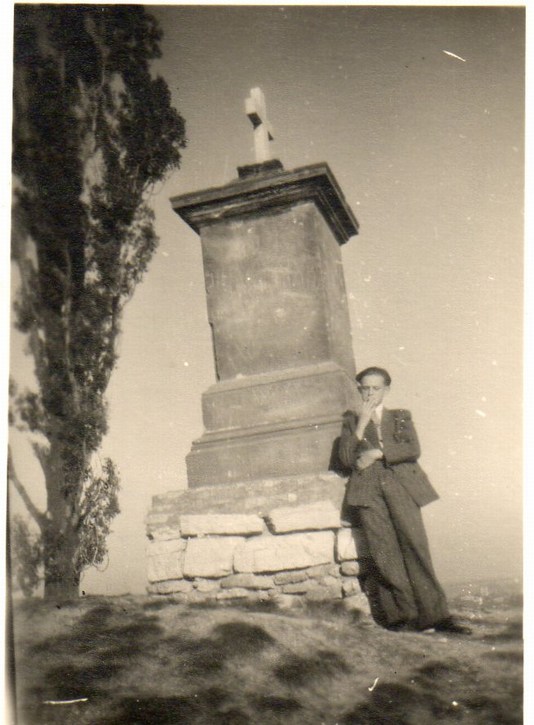
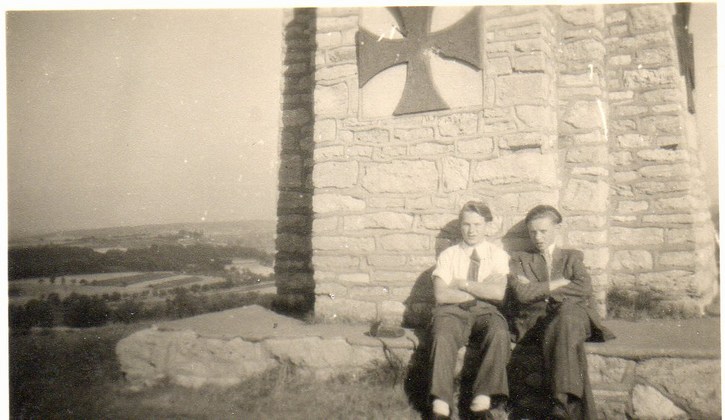
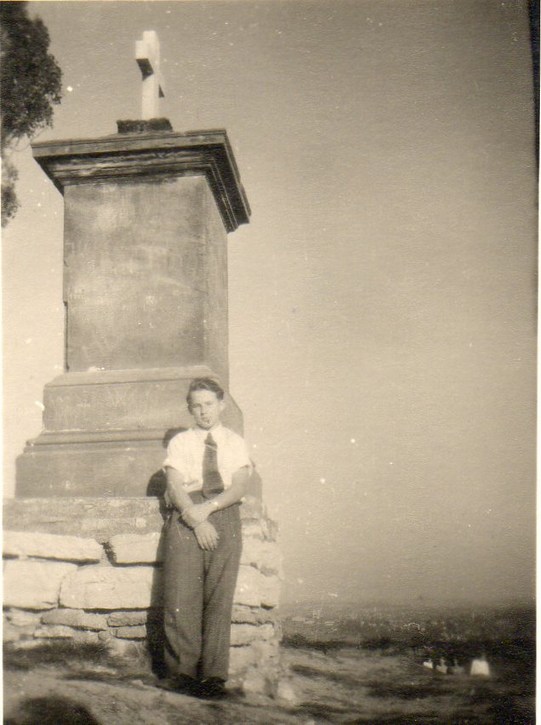
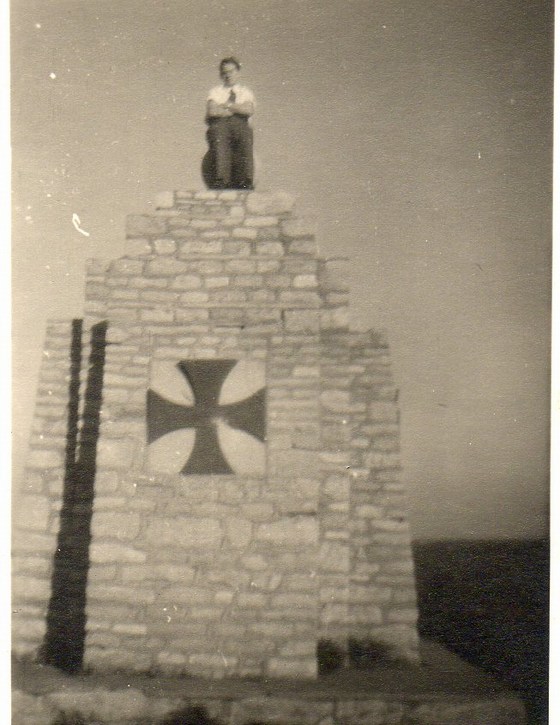
K-Heinz Schmidt auf dem Fuerst Heinrichstein 25.9.1949
Faszinierender Ausblick
Eine Wanderung zu den „Steinen“ lohnt sich – nicht so sehr der Steine wegen,
doch der Ausblick, der sich bietet , ist besonders im Frühjahr und im Sommer von
faszinierender Schönheit: Mühsam bahnt sich im Tal die Saale zwischen Fels und
Feldern ihren Weg vorbei an Weinbergen. Auf der anderen Seite des Tals erhebt
sich der Knabenberg, an dessen Fuß sich das in scheinbar tiefem Schlummer
liegende ehemalige Zisterzienserkloster Pforte schmiegt. Links grüßen die Türme
des Naumburger Doms, und wendet man sich etwas nach rechts, erblickt man den
Kurort Bad Kösen. Wer vom Wandern und Schauen müde und hungrig ist, kann am
Stein in Ruhe ein schönes Picknick machen.
Beachtliches Naturschutzgebiet und Bodendenkmal
Das Hochplateau über den Saalhäusern zählt zu den schönsten Punkten der näheren
Heimat. Orchideen und Silberdisteln sind neben anderen seltenen Pflanzen
vorhanden. Weniger bekannt ist, dass ein Teil als Bodendenkmal unter Schutz
steht. Ältere Karten verzeichnen diese Stelle als sogenannte Heuneburg,
Hünenburg oder Hunnenburg. Mit den Hunnen hat diese Burg nichts zu tun. Es
handelt sich um eine Fluchtburg mit Ringwall, von der es keine urkundlichen
Belege gibt. Sie stand oberhalb des klösterlichen Weinberges Omnium Sanctorum.
Ihre Spuren sind restlos verschwunden, waren aber noch vor mehr als 130 Jahren
zu sehen. Weithin sichtbar die beiden Steine auf dem Hochplateau.